
Wer den Film „Le Havre“ von Aki Kaurismäki gesehen hat, wird im Bereich künstlerisch narrativer Erzählweise wahrscheinlich nicht all zu viel von der alten und neuen Hafenstadt mitbekommen haben, aber Kaurismäki, der ein schweigsamer und schnörkelloser Filmemacher aus Finnland ist, thematisierte bislang in vielen Filmen Helsinki als Ort seiner Geschichten und seiner eigenwilligen und einzelgängerischen Helden des Alltags. Die Stadtsilhouetten von Helsinki und Le Havre scheinen für Kaurismäki sehr beieinander zu liegen, was mich allein wegen der Bilder aus der finnischen Hauptstadt nicht verwundert, obwohl ich noch niemals in Helsinki war, aber fast alle Kaurismäkifilme gesehen habe. Aki und sein Bruder Mika haben eine Filmsprache entwickelt, die eine Authenzität und Liebe zum „So ist es nun mal“ zeigen, wie sie in Europa formal und mit hintergründigem Landescolorit auch von Almodovar, Haneke, Rohrwacher, den Dardennes, Dresen oder Dumont praktiziert werden. Um nur ein paar wenige zu nennen, die mir ad hoc eingefallen sind.

Helsinki wurde während des Krieges nur geringfügig zerstört, aber um einen erhalten gebliebenen historischen Kern bauten die finnischen Architekten und Stadtplaner riesige Betonklotzsiedlungen und seelenlose Plattenbauten, die Kaurismäki inspiriert haben und in mir den Vergleich zur normannischen Hafenstadt entstehen ließen. Welche Beweggründe der Melancholiker Kaurismäki aber tatsächlich Le Havre zum Drehort für sein Flüchtlingsdrama wählte, ist nur sehr schwer herauszubekommen, vieles bleibt im Spekulativen, vieles wird der Filmemacher bei einer Flasche Vodka sicherlich zum Besten geben. Offensichtlich suchte er aus thematischen Gründen die europäische Küste nach einer geeigneten Hafenstadt aus und fuhr von Genua nach Marseille und von Marseille nach Sète, Barcelona, Valencia, Lissabon, Porto, Vigo und landete nach Abstechern in Nantes und Brest schließlich in Le Havre. Ich kann das nachvollziehen, weil diese Geschichte Authenzität für die Migrationsgeschichte brauuchte. Als er noch zweifelte und immer noch nicht zufrieden war, fuhr er nach Amsterdam und Rotterdam, um sich doch für die normannische Hafenstadt zu entscheiden. Seiner Meinung nach sei Le Havre die Stadt des Blues und des Rock´n Roll. Ich kann mir die jaulenden Gitarren der Leningrad Cowboys durchaus in den Vierteln außerhalb der City oder zwischen den Docks am Hafen vorstellen. Marcel Carné ist auch in Kaurismäkis Findungsprozess vorgekommen, vielleicht weil Aki K. „Hafen im Nebel“, „Hotel du Nord“ oder der „Tag bricht an“ genauer studiert hat, vielleicht aber auch wegen einiger Szenen aus „Drole de Drame“, die in seiner Vorstellungswelt durchaus Nahrung gefunden haben müssen. Hier und heute in Le Havre könnte ich allerdings nicht so klar beantworten, wie Carné und Kaurismäki geistig zusammengekommen sind, weil die Unterschiede zu groß sind. Kaurismäki meinte in einem Interview, dass Le Havre utopisch sei, weil er im Film alles so zeigt oder zeigen kann, wie es nicht ist. Liest man danach ein Interview mit der österreichischen Zeitung „Die Presse“ moniert er, dass die „wunderbare Architektur“ seiner Drehorte seither „durch Geld zerstört wurde“. In diesem Punkt kann ich ihm gerade in Le Havre nach mehreren weitläufigen Promeanden nur zustimmen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Einer der Filmkritiker grub noch tiefer und sah die kontrastreichen Lebenswelten der normannischen Hafenstadt als perfekte Kulisse für großes Kino. Darin liegt ein Funke Wahrheit, denn hier wurden mehr als hundert Spielfilme realisiert. Beispielsweise wurdet “ Claude Lelouches“ „Ein Mann und eine Frau“ in Le Havre gedreht.

Wohnhäuser mit Eglise St-Joseph
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die eben erwähnte „wunderbar schlichte und doch spektakuläre Architektur“ der Stadt zurückkommen, denn architektonische Experimente zeichnen „Le Havre“ aus, das nach der totalen Zerstörung im Krieg neue Zeichen gesetzt hat. Manche nennen das Stadtbild angenehm entspannend oder geordnet, andere verachten es als brutalistisch, abweisend und öde langweilig. Ich will versuchen herauszubekommen, welche Gründe es hat, das die Geister so scheidet. Im übrigen verweise ich auf all die so schönen und pittoresken Dörfer, die an der Küste liegen und denen eines gemeinsam ist: Der traditionell gepflegte Kern ist „hui“ und die „Appartementbunker“ an der Strandpromenade sind „pfui“. Le Touquet, Berck, Treport, Caubourg kenne ich und ob es Frankreich, Spanien oder Italien ist, überall sieht man die gleiche hässliche Fassadenmaske des Massentourismus.
Wir waren im Februar in Vallecrosia bei San Remo und offensichtlich haben wir das einzig schöne Wohnensemble in der Nähe der Küste erwischt, der ca. 3 km lange Strand mit der Promenade ergrauste in mir eine einzige bauliche Katastrophe. Jeder Quadrathmeter Strand, der einigermaßen vorzeigbar ist, wird von den Anlegern der Mischkalkulationsportfolien mit den üblichen Appartmenthäusern – vier hohe Wände mit vielen gleichgroßen Löchern, die fenster genannt werden – zugebaut. Corona hat für die Dauer der Impfstoffsuche den Profitgierjägern des „Betongoldes“ gezeigt, dass gerade die von tausenden frequentierten Ferienbunker höchste Ansteckungsgefahr für die Urlaubssüchtigen bedeuten können. Alles leer, keine Rendite, Privatanleger am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wer ehrlich ist, sieht die zugebaute Küste zwischen Palma de Mallorca und Andratx im allerhöchsten Fall als notwendiges Übel, die Mallorquiner, zumindest einige von ihnen, würden diese alles versperrende Wand aus Beton, Hohlblocksteinen und Stahlträgern am liebsten in die Luft jagen. Alle, die in Hurghada, La Grande Motte oder Antalya Ferien machen, sollten sich ihre periodisch genutzten Domizile mit etwas Abstand genauer anschauen. Aber wem Sonne, Meer und beste Verpflegung ausreicht, dem ist ohnehin in dieser Hinsicht nicht zu helfen. Oder glauben Sie, dass Gefängnisinsassen die sie umgebenden Mauern als besondere Note ihres Aufenthaltes betrachten würden?

Wir müssen für eine besseres Verstehen der Stadtgeschichte die Zeit noch einmal auf die zerstörerischen Tage im September 1944 zurückdrehen, um die Ursprünge des heutigen Le Havre in einem klareren Licht sehen zu können. 82 Prozent der bebauten Stadtfläche waren durch Flächenbombardierungen abrasiert worden, der Erdboden wurde in eine Trümmerwüste verwandelt und der überwiegende Teil der Menschen sah sich wohnungslos und in allergrößter Angst und Not vor dem, was kommen würde. Zu viele hatten diese Bombennächte mit ihrem Leben bezahlt, auch wenn sie nach überlieferten Berichten tatsächlich von der Bombardierung überrascht wurden, als die Tod und Zerstörung bringenden Flugzeugpulks den Himmel verdunkelten. Um einen derartigen himmlischen Unsegen hatten sie wahrlich nicht gebeten, als sie sich entschlossen in der Stadt zu bleiben. Hätte sich irgendein Havrais ausdenken oder voraussehen können, dass ausgerechnet die Briten ohne Rücksicht auf Verluste die Zukunft eines strategischen Masterplans für den Wiederaufbau in der Zukunft ermöglichen würden?
Die französische Bevölkerung wurde als Geißel deutscher Militärterroristen bei der Invasion der Alliierten von keinem der Besatzer geschont, zu groß war die Angst davor, in der Zerstörungswut und der Gnadenlosigkeit der NS-Verteidiger eine Niederlage zu erleiden, die einem Fiasko für alle gleich gekommen wäre. Was in den Generalstäben und den Diplomatentreffen in London und Washington vereinbart wurde, liegt für viele als Dokumentenstapel in den Archiven offen und Militärhistoriker haben im nachhinein ihren Reim aus den Fakten herausgefiltert, indem sie Vergleiche zwischen dem Potential der Besatzer und der Schlagkraft der Invasoren gezogen haben. Eines ist sicher und muss als These zuvorderst beachtet werden: Es ging nicht nur um die Befreiung Europas und der leidenden Menschen aus der Schreckensherrschaft der Nazis, es ging ebenso um die am Boden liegende Weltwirtschaft, um Rohstoffe und um eine weltumspannende, alles andere in den Schatten stellende Rüstungsindustrie.
Politiker und Wirtschaftslenker wussten sehr genau, dass es darum ging, zu retten, was zu retten war. Gleichzeitig waren sich alle im Klaren, dass es um die geopolitische Hoheit über unsere Erdkugel ging und wie sie von wem in Zukunft am profitabelsten zu dominieren und auszubeuten wäre. Ein vollkommen zerstörtes Europa, das wirtschaftlich in den letzten Zügen lag und die Weltwirtschaft aufs Äußerste belastete, konnte den Interessen der Amerikaner, der Briten oder der Russen nicht ins Konzept passen. Der Morgenthauplan scheiterte nicht zuletzt an denen, die vorausschauend begriffen, wie wichtig der europäische Kontinent im Kanon sämtlicher Kontinente war. Verband sie die gemeinsame Sache auch als Alliierte, die sich unter den widrigsten Umständen zusammengerauft hatten, so war allen Beteiligten klar, dass Europa die Schnittstelle zwischen dem westlichen Marktkapitalismus und dem östlichen Kommunismus mit seinem Dirigismus und einer verstaatlichten Wirtschaft war. Allen war bewusst, dass nach den zwölf Jahren gedungenem Staatsvandalismus deutscher Prägung eine neue Weltordnung geschaffen werden musste. Die Blocktheorie Ostkommunismus gegen Westkapitalismus war die unvermeidliche Folge, auch wenn der Krieg noch ein Jahr dauern sollte.

Während die Westallierten über Frankreich und Italien in Richtung Berlin marschierten, zogen die russischen Heeresverbände nach dem Sieg in Stalingrad 1942/43 unter unglaublich hohen Verlusten an Menschen und Material unaufhaltsam von Osten nach Berlin, in die Hauptstadt der NS-Verbrecher. Diese Endschlacht kannte in ihrer niemals vorher zu sehenden Wucht keine Gnade und zivile Opfer als kalkulierte Kolleteralschäden waren im Preis der Freiheit, der Ordnung und der Menschenwürde stets einberechnet. Le Havre war eingekesselt und musste eingenommen werden und den britischen Oberbefehlshabern in Absprache mit Eisenhowers US-Truppen blieb laut Militärstretategen, die in dieser Zeit die Befehlsgewalt hatten, nichts anderes übrig, als die Stadt, koste es, was es wolle, jeglicher Gegenwehr zu entledigen. Die Bomben erledigten den Rest.

Le Havre lag am Boden, der wichtigste Hafen am Kanal und zum Atlantik und einer der wirtschaftlichen Brennpunkte für ein politisch funktionierendes Frankreich, das immerhin als vierter Allierter mit im Boot saß. Zu Recht, denn ohne den unbedingten Willen der französischen Exilregierung und vielen anderen exilierten Hoheitsvertretern anderer besetzter Länder, die von London aus operierten, wären die militärischen Entscheidungsschlachten von einigen Zauderern und klammheimlichen Kriegsgewinnlern vielleicht verzögert worden. On vera.

Der 71jährige belgisch stämmige Architekt und Stadtplaner Auguste Perret, der zwischen 1920 und 1954 weltweit Projekte realisierte, wurde von der neuen französischen Regierung beauftragt, einen Wiederaufbauplan für Le Havre zu erstellen. Perret war ein bekannter und ausgewiesener Fachmann und hatte schon in einigen Ländern Europas wie in Frankreich oder Großbritannien als Architekt, Stadtplaner und Bauunternehmer reüssiert. Bauhistoriker ordnen seinen Stil in der Tradition der französischen Rationalisten ein (von Durant über Labrouste, Viollet-Le-Duc, De Baudot, Guadet bis Choisy). Perret war der Avantgardist des armiertem Betons, dessen Ideen und Realisierungen von vielen nach dessen Tod wieder aufgenommen wurden. Man nannte seine Arbeiten zuweilen auch „Poesie in Beton“. Als Städtebauer erregte er Aufsehen, als er 1931 den Palast der Sowjets in Moskau bauen ließ.

In seinem „Atelier Perret“, das er schon in den 40er Jahren gegründet hatte, beschäftigten sich die Mitglieder mit Plänen für den ganzheitlichen Wiederaufbau zerstörter Städte. Mit seinem Planungsstab von 60 Architekten begann er schon 1945 mit der Arbeit. Bis 1954 wurden die meisten Bauten hochgezogen. Aber nicht nur neue Wohnblocks entstanden im neuen Le Havre, die Architekten und Stadtplaner dachten an alles: Einkaufsstraßen, Kulturzentrum, Kirchen, Schulen und öffentliche Gebäude. Perret verfocht die Ansicht „Licht, Luft, Sonne“ und richtete die Gebäude am Sonnenverlauf aus. Die zwangsläufig entstehenden Innenhöfe wurden großzügige Gemeinschaftsgärten und verkamen leider mit der Zeit der zunehmenden Automobilität als Abstellplätze für den Fetisch Personenkraftwagen. Die Baumaterialien, die äußerst rar waren, bestanden aus Sand und den zermahlenen oder zerkleinerten Trümmern der zerstörten Gebäude. Alles wurde pedantisch nach Farben und Materialien geordnet, so dass seine Idee, die Gebäude „lebendiger“ werden zu lassen, möglich wurde.

Vor Beginn der Arbeiten lagen 133 Hektar Trümmerlandschaft brach, was einerseits ein Albtraum hätte werden können, aber für einen Visionär als Traum verstanden wurde, um auf einem so großen Terrain stilistische Ideen und soziale Visionen Wirklichkeit werden zu lassen, wie sie ansonsten kaum ein Städteplaner vorgefunden hätte. Perret, bekannt als Meister der Betonbaukunst, schuf hier mit seinen Sichtbetonbauten Denkmale für die Ewigkeit. Beton, zumal als Sichtflächen wurden damals argwöhnisch beobachtet und genügend Baumeister einer eleganten und elitären Architektur, wollten sich sich mit einer außergewöhnlichen, aber teilweise überlebten Formensprache in den Vordergrund stellen. Über Perrets Stil rümpften viele die Nase. Er agierte nach eigenen Vorstellungen und hielt sich an die Ordnung streng geometrischer Planungsvorgaben. Trotzdem variierte er das neue entsandene Wohnviertel durch unterschiedliche Gebäudehöhen und miteinander korrespondierenden Standflächen.

Das Wohnen in den neuen Gebäuden entwickelte sich für die Havrais zu einem entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität. Die ca. 100 m² großen Wohnungen wurden mit Kinder- und Schlafzimmer ausgestattet, die zum hofseitigen Bereich gelegen waren. Wohnzimmer oder Arbeitsraum wurden zur Straße hin ausgerichtet. Schmuckstück der Appartements waren die Bäder, deren Großzügigkeit selbst heutige Bedürfnisse übertreffen. Flexible Schiebetüren und Glaseinsätze in den Türen gaben dem Tageslicht die Chance das Wohnungsinnere hell und behaglich zu machen.

Nacht in Le Havre
Als Stadtzentrum wurde das neue Rathaus mit seinem hohen Turm inmitten des westlichen Parts der Innenstadt auf einem sehr weitläufigen Platz erbaut. Vor dem Krieg lag hier das Zentrum Le Havres. Neben dem überdimensional hohen Kirchturm der Eglise St. Joseph mit seinen 107 Metern Stahlbeton und einem Glasfensterteppich, der einer Vielzahl bunter, aneinandergereihter Luken ähnelt, ragt der trotzige Turm des Rathauses als wehrhafter moderner Burgfried aus dem ihn umgebenden Häuserensemble. Perret hielt sich relativ genau an die Standpunkte der wichtigsten Gebäude, die vor dem Krieg das Bild Le Havres prägten und schuf mit einer zukunftsweisenden, großzügigen Staßenstruktur einen urbanen Grundriss, der genügend Platz für alle Lebensräume und einem Mobilitätssystem bot und schon 1954 auf die Zukunft ausgerichtet war.
Die Gesamtfläche des neuen Stadtbildes gleicht einem überdimensionalen Dreieck und wird von drei weiträumigen Straßenzügen begrenzt, die sich durch die gesamte Stadt ziehen. Auch die historischen Hafenbecken blieben bestehen. So wurden Hafen, Innenstadt, Außenbezirke und die Seinemündung am Meer in das Konzept eingebunden. Aus der Ferne betrachtet, sieht alles streng symmetrisch aus, entfaltet sich aber aus der Nähe als erstaunlich komplexer Raum. Eines der beiden alten Hafenbecken wurde vor einigen Jahren durch den Architekten Jean Nouvell von einem großen Multierlebnisbad flankiert. Weil die Höhe aller Wohnbauten variieren, bilden sie in ihren Proportionen die Silhouette eines stufigen Dächergebirges, das vor allem im Abendlicht eine außerordentlich magische Anziehungskraft ausstrahlt.

https://bauwelt.de/dl/731329/10815695_500108bdb3.pdf
Joseph Abram, Le Havre ist Weltkulturerbe, Eine bahnbrechende Entscheidung der UNESCO
https://www.welt.de/reise/staedtereisen/article170392374/Le-Havre-ist-Poesie-in-Beton.html
Veröffentlicht am 08.11.2017 – Von Hans Schloemer

Orthogonal heißt die Zauberformel Perrets bei der Entwicklung des neuen Stadtplans, der rechte Winkel sowie die horizontalen Ebenen, die in einem Ordnungssystem zueinanderstehen und in den Abgrenzungen viel freien Raum lassen, beruhten einerseits auf ästhetischen Prinzipien und andrerseits musste Perret aus rationalen und finanziellen Gründen mit einbeziehen, dass das Bauen dieses riesigen Areals zügig fertig gestellt wurde. Geld und Material spielte eine entscheidende Rolle in der Entstehung der neuen Stadt auf den Grundmauern der Havraiser Geschichte.

Die streng strukturalistische Bauweise mit Anleihen aus der antiken Bauweise, die mit zurückgenommenen Verzierungen und Ornamenten die groben, eindimensionalen Fassaden aufbrachen, bezeichnet man in der Architektur als strukturellen Klassizismus. Ähnliches habe ich in Montpellier im neuen Wohnviertel ANTIGONE des Architekten Ricardo Bofill gesehen, allerdings erschien mir dort das Gesamtbild als zu steril und wenig reizvoll.

Stahlbeton wurde zu jener Zeit fast ausschließlich für Industriebauten verwendet, die in riesigen Komplexen tausenden Menschen Arbeitsplätze sicherten. Perret galt und gilt als der Pionier des Stahlbetons und erst Jahre später folgten Le Corbusier und Plecnik und deren Entwürfen, ohne den Wert der von diesen Architekten entstandenen Bauformen irgendwie schmälern zu wollen.
Übrigens muss unbedingt Oscar Niemeyer erwähnt werden, der zum einem das Kulturzentrum Volcan in der Stadtmitte entwarf und in vielen Bereichen mit Perret im Dialog stand. Volcan, das Kultur- und Veranstaltungszentrum heißt deshalb so, weil es tatsächlich einem Vulkan ähnelt. Die Zentrale der KPF in Paris stammt auch aus Niemeyers Büro. Ich durfte vor einigen Jahren hinein und konnte alles fotografieren. Mit seinem filigranen Beleuchtungskonzept in der großen Aula, zeigt Niemeyer, welch Ausnahmetalent der Brasilianer war, der Materilien nutzte, wie keiner vor ihm und Konstruktionen erdachte, die erst von einer neuen Architektengeneration zum Ende des Jahrhunderts wieder aufgegriffen wurden.
Brasília gehört ebenso zu den größeren Städten, die nach dem Krieg auf dem Reißbrett entstanden, auch wenn die Hauptstadt des Landes mitten im Urwald gebaut wurde und lange Zeit eher gemeiden wurde, ist Brasilia inzwischen eine lebendige Hauptstadt des Landes. Niemeyer war ebenso wie Perret ein Ästhet und Formgeber, der die Zukunft beeinflusst hat, aber vielleicht an der Gier nach Profiten, die alles Störende und Ästhetisierte beiseite schob, in späteren Jahren zu wenig internationale Beachtung fand. Beide konnten nicht voraussehen, dass sich das Bauwesen aus einer Architektur der schönen Formen und den Prinzipien des Nützlichen entkoppelte und eine schleichende ästhetische Zerstörung der Stadtbilder einleitete. Davon können deutsche Städte und deren Bewohner ein Lied singen. Auch Köln, Hamburg und Stuttgart waren stark vom Krieg mitgenommen, aber in diesen Städten setzte sich die Effizienz des kostengünstigen und schnellen Bauens durch, was dazu führte, dass jeder so baute, wie er es seiner Meinung für schön hielt und dadurch billige und unattraktive Häuser entstehen lassen konnte. Die Innenstadt von Köln muss ich trotz vieler gut erhaltener und restaurierter Häuser und Kirchen als einen Flickenteppich der ästhetischen Barbarei bezeichnen. In einer Beziehung hat Köln aber ein vorzeigbares Ensemble: Als man um den Dom und gegenüber dem Hauptbahnhof mit der Hohenzollernbrücke das Museum Ludwig und das Römisch-Germanische-Museum integrierte.
Am 15. Juli 2005 zeichnete die UNESCO Le Havre als Weltkulturerbe aus und würdigte damit diese großartige Leistung, die Le Havre wieder aufleben ließ und der Stadt eine den Ansprüchen der Zeit zukunftsweisende Gestaltung schenkte.
Würde nur der Dom als einziges Traditionsgebäude über Köln wachen und kein einziges Hochhaus unter 156 Metern wäre erbaut worden, würden sich Le Havre und die Domstadt einander ähneln. Die in der Bombennacht zerstörte Kirche St-Joseph gab es nicht mehr, aber Perret ließ einen Kirchturm bauen, der die gesamte Stadt und das Seinedelta monolithisch überragte. Dieser Turm schien mir so, als hätte ein Riese einen Pfahl in das Dreieck zwischen Seine und Strand gerammt. Die Kirche ist nicht nur eine monumentale Erscheinung, sie dokumentiert wie ein Leuchtturm den Überlebenswillen der Havrais. Der aus beige-grauen Betonteilen in den Himmel ragende Turm zwischen Fluss und Meer strebt in eine Dimension, von der man nur sagen kann, dass sich Himmel, Erde und Meer miteinander verbunden haben. Saint-Joseph ist das zu Stein gewordene Fanal des Wiederaufbaus, ein Symbol von Mut und Stärke. Bauingenieure und Architekten werden beeindruckt sein, wenn von 700 Tonnen Stahl, 50.000 Tonnen Beton, 71 Pfählen, die 15 Meter im Boden verankert sind, gesprochen wird.
Ein griechisches Kreuz stand Pate für den quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von 40,6 Metern. Der achteckige Laternenturm ruht fest auf vier freistehenden Pfeilern. Den Innenraum der Kirche zu beschreiben muss jeder für sich selbst in Worte fassen, sofern einem überhaupt Worte einfallen. Ein senkrecht stehendes Kaleidosscoop, das je nach Lichtverhältnissen und Sonneneinstrahlung einen einzigartigen Farbenrausch entstehen lässt. Es war die Glaskünstlerin Marguerite Hurè, die die robust filigrane Betonkonstruktion mit mundgeblasenen Glasfensterchen zum Leuchten brachte. 12.768 Zierfenster reihen sich in geometrisch exakt berechneten Proportionen aneinander und die gesamte Farbenpracht besteht aus nur sieben Farben mit rund fünfzig Abstufungen: orange, gelb, grün, violett, rot, blau, weiß. Vielleicht hat Gerhard Richter dieses Farbwunder aus Glas gesehen, bevor er am Computer das Fenster für den Dom entwickelte.

Die Architektur Perrets und im Speziellen das Stadtensemble von Le Havre füllen Bücher, allerdings weiß der Laie oder der Tourist, auch der umherirrende Kreuzfahrtschiffer (die halten auch kurz hier) wenig über das urbane Erlebnis Le Havre. Wie auch, denn selbst bei den Digitaldieben von google muss man tief bohren, um an Material zur Geschichte zu kommen. Hinzu kommt, dass in Frankreich das Suchportal zunächst alles auf französisch anbietet, was ich noch einigermaßen zu deuten weiß, aber ich schreibe einen Blog und keine wissenschaftliche Arbeit über diese Stadt.
Heute wagte sich so ein Schiffsmonster an die croisieres, war aber bald wieder verschwunden. Was wollen die Champagnerlümmel und Belugaverschnittverkoster auch bei den Maqueraux und normannischen Dickschädeln. Heiter soll es sein und unbeschwert, wenn man so eine Schiffsreise unternimmt. Allein der Gang zum Buffet kann nach acht Tagen Völlerei schon einen Myokardinfarkt auslösen. Also ran an die Cocktails und schnell Richtung Südwesten, wo die Sonne das kleine bißchen Mehr verspricht.
Bei meinem Gang durch die Stadt, den ich heute, bewaffnet mit zwei Kameras, unternommen habe, stieß ich auf einige Einzigartigkeiten, die noch erwähnenswert wären. Zum einem liegt ganz in unserer Nähe ein altes Fort und ein sehr geräumiger Cimetiere, wo ich Fotos schießen wollte. Das Fort entpuppte sich als alternatives Experimentierfeld für „les Jeunes“ und alle die so tun, als seien sie noch jeune und bot gleich nebenan ein kleines Restaurant einen Ort der Kontemplentation und drumherum gab es Spielstätten für individuelle Sportarten. Unter anderem gibt es dort eine Petanquebahn. Und am Wochenende wird laut einem kundigen Angestellten des öfteren Lifemusik veranstaltet. Ob das zu Coronazeiten auch so ist, wird die französische Seele unter sich ausmachen müssen.
Busfahren gestaltet sich mühsam. Ich habe mir zwar eine Karte für 20 einstündige Fahrten gekauft, aber die Busse waren bisher immer sehr voll, wobei ich leider Schwierigkeiten habe, mit den beiden Kameras auch noch die Maske aufzusetzen. Es würde aber wahrscheinlich nicht auffallen, wenn ich es vergäße oder mich verweigern würde, denn mindestens ein Drittel der Transportierten verzichtet vollkommen auf den Schutz der anderen. Es war wieder einmal der falsche Bus oder die falsche Haltestelle, wer weiß das schon und ehe ich mich versah, war ich an einem Ort, wo ich eigentlich nicht hinwollte. So stand mir wieder ein längerer Gang bevor, der aber direkt an der Seine lag- Ich sah das Museum Malraux, den kleinen Turm der Hafenüberwachung und ein paar Überrreste der Skulpturenausstellung, die vor ein paar Jahren hier veranstaltet wurde.
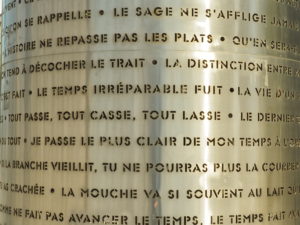
Skulptur in der Nähe des Bahnhofs
Ich sah aber auch das, was mich erschrecken ließ, denn neben dem wohlgeordneten Betonklassizismus von Perret wird wie wild gebaut und ein nagelneuer Plattenbunker mit Verglasung und Laufstallbalkonen ist noch hässlicher als der andere. Der gesamte vordere Teil der Strandpromenade wird mit Hochdruck in eine Konformitätszone verschandelt. Die Vorbilder kenne ich wohl, denn Marbella, Benidorm und Scheweningen sind in dieser Hinsicht keiner Würdigung wert. Die neuen Blocks an der Seine sind nicht so groß und dürfen niemals niemals höher sein als die Bauten Perrets. Trotzdem fällt wieder der Satz „Gier frisst Geld“ und „Geld gebärt Gier“.
Wie schön es doch ist durch die breiten Boulevards zum Rathaus zu schlendern, um dann schon relativ müde zum Funiculair zu trotten und gemächlich in der kleinen von einem Stahlseil gezogenen Bahn die 77 Meter zu unserer Straße zu überwinden.
Quelle
Hendrik Bohle ist Architekt, Autor und Stadtforscher
siehe auch
http://www.philosophiekunst.com/wp-content/uploads/2017/03/newsletter_2014_08.pdf
http://www.philosophiekunst.com/wp-content/uploads/2017/12/Newsletter_Kunstkritik_022017.pdf
W. Neisser – geändert 8/2021
